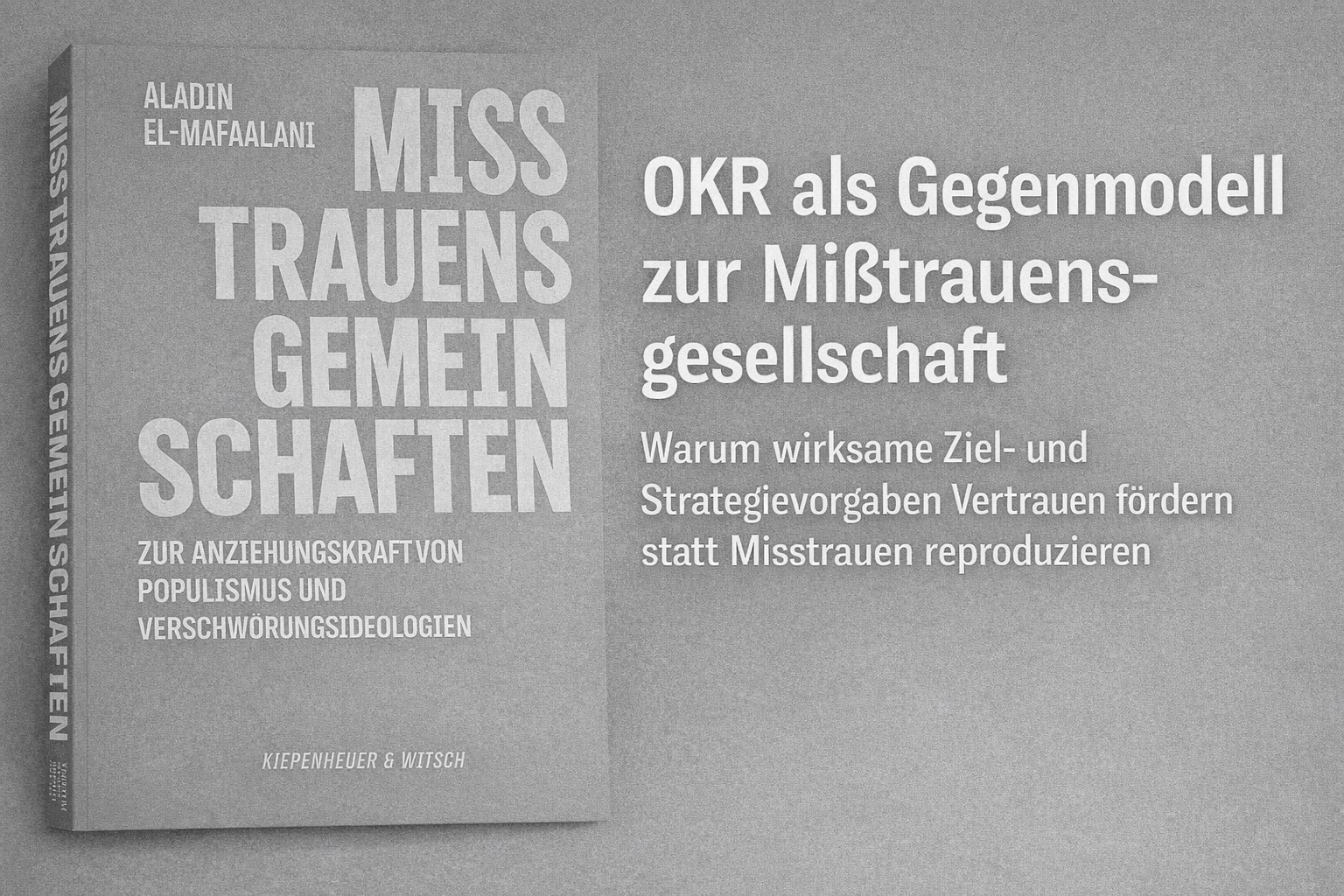Einleitung: Warum die Unterscheidung so entscheidend ist
Organisationen stehen heute vor der Herausforderung, in einer hochgradig komplexen und dynamischen Umwelt zu handeln. Strategien sind oft nicht mehr langfristig planbar, und klassische Steuerungslogiken geraten an ihre Grenzen. Genau hier setzen Objectives and Key Results (OKR) an – als agiles Führungs- und Steuerungsmodell, das Wirkung (Outcome) in den Mittelpunkt stellt.
Doch innerhalb der OKR-Diskussion taucht immer wieder eine zentrale Frage auf:
Warum und wie unterscheiden wir eigentlich Lag-Measures und Lead-Measures?
Und noch wichtiger: Wie schaffen wir es, dass beide Outcome-orientiert gedacht werden – anstatt in die Falle von Output- oder gar Impact-Fixierung zu tappen?
Die Unterscheidung ist deshalb so entscheidend, weil Lag- und Lead-Measures zwei unterschiedliche Zeithorizonte von Wirkung beschreiben:
- Lag-Measures zeigen uns, ob wir am Ende tatsächlich erfolgreich waren – sie sind der „Blick in den Rückspiegel“. Sie beantworten die Frage: „Ist das gewünschte Ergebnis eingetreten?“
- Lead-Measures dagegen geben uns eine frühe Rückmeldung, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Sie wirken wie „Frühwarnsysteme“, die uns Hypothesen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in der Organisation überprüfen lassen: „Zeigt sich schon jetzt eine Veränderung, die später zu unserem Ziel führt?“
Beide sind also nicht Gegensätze, sondern ergänzende Perspektiven auf Outcome. Ohne Lag-Maße fehlt die Bestätigung, ob wir am Ende Wirkung erzielen. Ohne Lead-Maße fehlt uns die Möglichkeit, unterwegs Hypothesen zu prüfen und rechtzeitig nachzusteuern.
In komplexen, dynamischen Kontexten ist diese Kombination unverzichtbar: Nur so können Organisationen Lernen in Echtzeit ermöglichen und vermeiden, dass sie Wochen oder Monate im Blindflug agieren.
1. Begriffsbestimmung: Lag vs. Lead
1.1 Lag-Measures
- Definition: Indikatoren, die eine nachgelagerte Wirkung messen, d.h. nachträglich den Erfolg in der Wirkung aufzeigen. Sie zeigen, ob ein gesetztes Ziel tatsächlich erreicht wurde.
- Beispiele: Gewinn, Umsatzsteigerung, Kundenzufriedenheit (NPS), Mitarbeiterbindung, Marktanteil, ...
- Charakteristik: Sie sind ex-post (retrospektiv) messbar. , hängen aber von vielen Faktoren ab, die außerhalb unserer direkten Steuerung liegenman sieht erst im Nachhinein, ob das Ziel erreicht wurde.
1.2 Lead-Measures
- Definition: Indikatoren, die einen frühen Hinweis darauf geben, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Sie messen veränderbares Verhalten oder Prozesse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem gewünschten Ergebnis führen.
- Schlechte Beispiele (Output):
- Anzahl qualifizierter Kundenkontakte → misst Aktivität, nicht Wirkung.
- Häufigkeit von Nutzerinterviews → zeigt Fleiß, aber nicht, ob Erkenntnisse Verhalten verändern.
- Time-to-Feedback bei Features → ist ein Prozessindikator, sagt aber noch nichts über Kundenverhalten.
- Trainingsstunden für Führungskräfte → erfasst Aufwand, nicht den Effekt auf Führungshandeln.
- Gute Beispiele (Outcome):
- Qualität der Kundenkontakte: „Mindestens 70 % der neu kontaktierten Leads passen in unsere definierte Zielgruppe und zeigen aktives Kaufinteresse.“
- Wirksamkeit von Nutzerinterviews: „80 % der durchgeführten Interviews liefern mindestens eine umsetzbare Erkenntnis, die innerhalb von zwei Wochen ins Backlog übernommen wird.“
- Feedback-Nutzung bei Features: „70 % der Nutzer:innen, die Feedback geben, sehen ihre Rückmeldungen innerhalb von vier Wochen in Produktverbesserungen umgesetzt.“
- Führungsverhalten nach Trainings: „90 % der Führungskräfte wenden mindestens eine erlernte Technik in ihren nächsten Teammeetings an und berichten von veränderter Reaktion im Team.“
- Charakteristik: Sie sind (indirekt) beeinflussbar, zeigen frühzeitig Trends, sind aber nur dann wertvoll, wenn sie tatsächlich outcome-orientiert gewählt sind.
2. Outcome-Orientierung
2.1 Was verstehen wir unter „Outcome“?
Im die.agilen-Ansatz definieren wir Outcome als:
„Eine Veränderung im Verhalten von Menschen (idealerweise Kund:innen), welches unser Geschäft positiv beeinflusst.“
Das heißt: Outcome bedeutet nicht mehr Umsatz, nicht höhere Stückzahlen, nicht mehr interne Projekte – all das sind Lag-Indikatoren oder reine Output-Größen. Outcome zeigt sich immer dann, wenn Menschen – Kund:innen, Nutzer:innen, Mitarbeitende oder Partner – etwas anders tun als zuvor.
Beispiele:
- Kund:innen nutzen eine neue Funktion regelmäßig, anstatt sie zu ignorieren.
- Mitarbeitende sprechen Konflikte im Team offen an, anstatt sie zu verschweigen.
- Neue Kund:innen entscheiden sich schneller für unser Produkt, anstatt lange zu zögern.
2.2 Warum ist Outcome so essenziell?
Gerade in einer Welt, die durch hohe Dynamik und Komplexität geprägt ist, verlieren klassische Steuerungsgrößen ihre Wirksamkeit.
- Umsatz, Gewinn oder Marktanteile sind zwar wichtig, sie treten jedoch erst zeitverzögert ein und sind stark von äußeren Faktoren beeinflusst.
- Output-Messungen (z. B. Anzahl von Features, durchgeführte Workshops, Marketingkampagnen) sagen wenig darüber, ob diese Aktivitäten tatsächlich Verhalten verändern – und damit echten Wert schaffen.
Nur Outcome erlaubt es uns, direkt und zeitnah zu überprüfen, ob unser Handeln Wirkung entfaltet. Outcome wird so zum Brückenschlag zwischen Strategie und Realität: Es verbindet, was wir erreichen wollen (Objective), mit dem, was Menschen tatsächlich anders tun (Key Results).
2.3 Die systemtheoretische Perspektive
Aus Sicht der Systemtheorie (Luhmann u.a.) gilt:
- Organisationen sind geschlossene soziale Systeme, die Umweltereignisse nicht einfach linear „aufnehmen“, sondern selektiv verarbeiten.
- Input ≠ Output: Mehr Ressourcen, mehr Projekte oder mehr Meetings führen nicht automatisch zu besserer Wirkung, weil jedes System Reize nach seiner eigenen Logik verarbeitet.
- Wirkliche Veränderung tritt nur dann ein, wenn die Organisation es schafft, Verhaltensmuster in der Umwelt zu beeinflussen – sei es bei Kund:innen, Mitarbeitenden oder Partnern.
Daraus folgt:
- Outcome-Orientierung zwingt uns, über die Systemgrenze hinauszudenken. Nicht was wir tun (Output), sondern was andere dadurch anders tun (Outcome), entscheidet über Erfolg.
- Gerade bei hoher Dynamik und Komplexität ist dies unverzichtbar: Nur wenn wir Verhalten beobachten und messen, können wir Rückkopplungen erkennen, Hypothesen überprüfen und unser Handeln adaptiv anpassen.
2.4 Praxisbeispiel
Ein Software-Team liefert in kurzer Zeit zehn neue Features (Output).
- Doch die Kund:innen nutzen keines davon regelmäßig – Outcome = null.
- Die Organisation hat Zeit und Ressourcen verbraucht, aber keinen Wert geschaffen.
Wird dagegen nur ein Feature entwickelt, das tatsächlich eine Verhaltensänderung auslöst (z. B. 70 % der Nutzer:innen nutzen es innerhalb von zwei Wochen regelmäßig), ist Outcome erreicht – und damit die Grundlage für langfristigen Geschäftserfolg.
3. Wirkung in Komplexität: Outcome-orientierte Key Results
Ein häufiges Missverständnis in der Praxis:
- Lag = Outcome
- Lead = Output
Doch das ist zu kurz gedacht. Damit wir in der Komplexität und Dynamik erfolgreich sein können, müssen beide – Lag und Lead – outcome-orientiert sein.
Das bedeutet: Sowohl das „End-Ergebnis“ als auch die „frühen Indikatoren“ messen, ob sich Verhalten und Systeme so verändern, dass sie echte Wirkung entfalten.
Beispiel negativ (klassisch):
- Objective: „Wir steigern unseren Umsatz im Q4“
- Lag-KR: „+10 % Umsatzsteigerung“ (Outcome)
- Lead-KR: „50 Sales-Calls pro Woche“ (Output)
Hier liegt das Problem: Die Lead-Maßnahme ist Output. Sie misst Aktivität, aber nicht Wirkung. 50 Sales-Calls können genauso gut sinnlos sein, wenn die falschen Kunden angerufen werden.
Beispiel positiv (outcome-orientiert):
- Objective: „Unsere Kunden treffen schneller Kaufentscheidungen, weil sie unser Produkt verstehen“
- Lag-KR: „Durchschnittliche Sales-Cycle-Dauer sinkt von 90 auf 60 Tage“
- Lead-KR: „Mindestens 70 % der Interessenten verstehen den USP nach dem ersten Gespräch“
Hier sind beide Measures outcome-orientiert: Der Lag zeigt die späte Wirkung, der Lead die frühe Wirkung einer besseren Argumentation.
3. Systemtheoretische Perspektive: Warum Outcome-orientierte Lead-Measures unverzichtbar sind
Die Systemtheorie (Luhmann u.a.) lehrt uns: Organisationen sind autopoietische Systeme. Sie reagieren nicht linear auf Input, sondern verarbeiten Reize nach ihrer eigenen Logik.
Konsequenzen:
- Kausalität ist nie direkt – mehr Aufwand führt nicht automatisch zu mehr Wirkung.
- Feedback-Schleifen sind entscheidend – nur wer frühe Signale misst, kann Hypothesen überprüfen.
- Fokus auf Output oder Impact ist riskant – Output ignoriert Systemlogik, Impact ist oft nicht zurechenbar.
Daraus folgt:
- Key Results müssen Hypothesen repräsentieren.
- Beispiel: „Wenn wir unseren Onboarding-Prozess vereinfachen, steigt die Aktivierungsrate.“
- Lead-Measures sind outcome-orientierte Frühindikatoren.
- Beispiel: „80 % der neuen Nutzer schließen das Setup innerhalb von 10 Minuten ab.“
- Lag-Measures validieren die Hypothese auf längere Sicht.
- Beispiel: „Aktivierungsrate steigt von 45 % auf 70 %.“
4. Gefahren bei falscher Anwendung
4.1 Zu starker Fokus auf Output
- Beispiel: „Wir führen 20 User-Interviews pro Woche.“
- Gefahr: Interviews werden zum Selbstzweck, ohne dass das Verhalten der Nutzer oder die Produktqualität verbessert wird.
- Folge: Ressourcenverschwendung, Zynismus im Team.
4.2 Zu starker Fokus auf Lag (reine Ergebnisorientierung)
- Beispiel: „Wir steigern den Umsatz um 15 %.“
- Gefahr: Keine Steuerung möglich, da erst am Quartalsende sichtbar.
- Folge: Reaktives Handeln, oft durch Druck und Micromanagement.
4.3 Impact-Fixierung
- Beispiel: „Wir verbessern das Weltklima durch unser Produkt.“
- Gefahr: Impact liegt außerhalb des Systems (politische Rahmenbedingungen, globale Märkte).
- Folge: Frustration, weil Erfolg nicht eindeutig messbar ist.
5. Praxisbeispiele aus der OKR-Einführung
Positiv
- Healthcare-Unternehmen:
- Lag: „Reduktion der Wiederaufnahmen nach einer OP von 12 % auf 8 %“
- Lead: „90 % der Patienten verstehen nach dem Erstgespräch ihren Reha-Plan“
- Wirkung: Frühindikator (Verständnis) korreliert mit späterem Outcome (geringere Wiederaufnahmen).
- SaaS-Startup:
- Lag: „Churn-Rate sinkt von 7 % auf 4 %“
- Lead: „80 % der Nutzer verwenden das neue Dashboard innerhalb der ersten 2 Wochen“
- Outcome-orientierter Lead zeigt, ob Produktverbesserung greift.
Negativ
- Retailer:
- Lag: „+5 % Umsatzsteigerung“
- Lead: „300 neue Produkte gelauncht“
- Typisches Output-Denken: Mehr Produkte = mehr Umsatz? In der Realität sinkt die Profitabilität.
6. Ableitung: Die Rolle von Hypothesen
OKRs sind im Kern Hypothesen-getriebene Steuerungssysteme:
- Wir formulieren eine Annahme, welche Veränderung zu welchem Outcome führt.
- Lag-Measures validieren ex-post.
- Lead-Measures prüfen Hypothesen frühzeitig.
Ohne outcome-orientierte Lead-Measures wird OKR zu einem Nachverfolgungssystem, das lediglich auf Ergebnisse schaut – und das ist zu spät, um wirksam zu sein.
7. Handlungsempfehlungen für die Praxis
- Frage bei jedem Key Result: Misst es eine Verhaltensänderung oder Systemänderung, nicht bloß Aktivität?
- Kombiniere Lag und Lead bewusst: Ein OKR-Set ohne beide Dimensionen bleibt einseitig.
- Denke in Hypothesen: „Wenn wir X tun, dann passiert Y“ – und überprüfe mit Lead-Maßnahmen.
- Vermeide Output-Maßnahmen: Wenn es nur die Menge der Aktivität misst, überarbeite es.
- Habe Mut zur Revision: Wenn Lead-Measures nicht wirken, Hypothese ändern – nicht einfach „mehr machen“.
Fazit
Der Unterschied zwischen Lag- und Lead-Measures ist nicht nur eine technische Feinheit im OKR-Prozess, sondern der entscheidende Hebel für Wirksamkeit.
Nach dem die.agilen-Ansatz gilt:
- Beide müssen outcome-orientiert sein.
- Beide müssen Hypothesen reflektieren.
- Beide sind systemtheoretisch zu verstehen – nicht linear, sondern als Signale in einem komplexen System.
Wer dies missachtet, läuft Gefahr, in Output-Fallen oder Impact-Illusionen zu tappen. Wer es beherzigt, schafft Klarheit, frühzeitige Steuerung und nachhaltige Wirkung – genau das, was moderne Organisationen in unsicheren Zeiten brauchen.