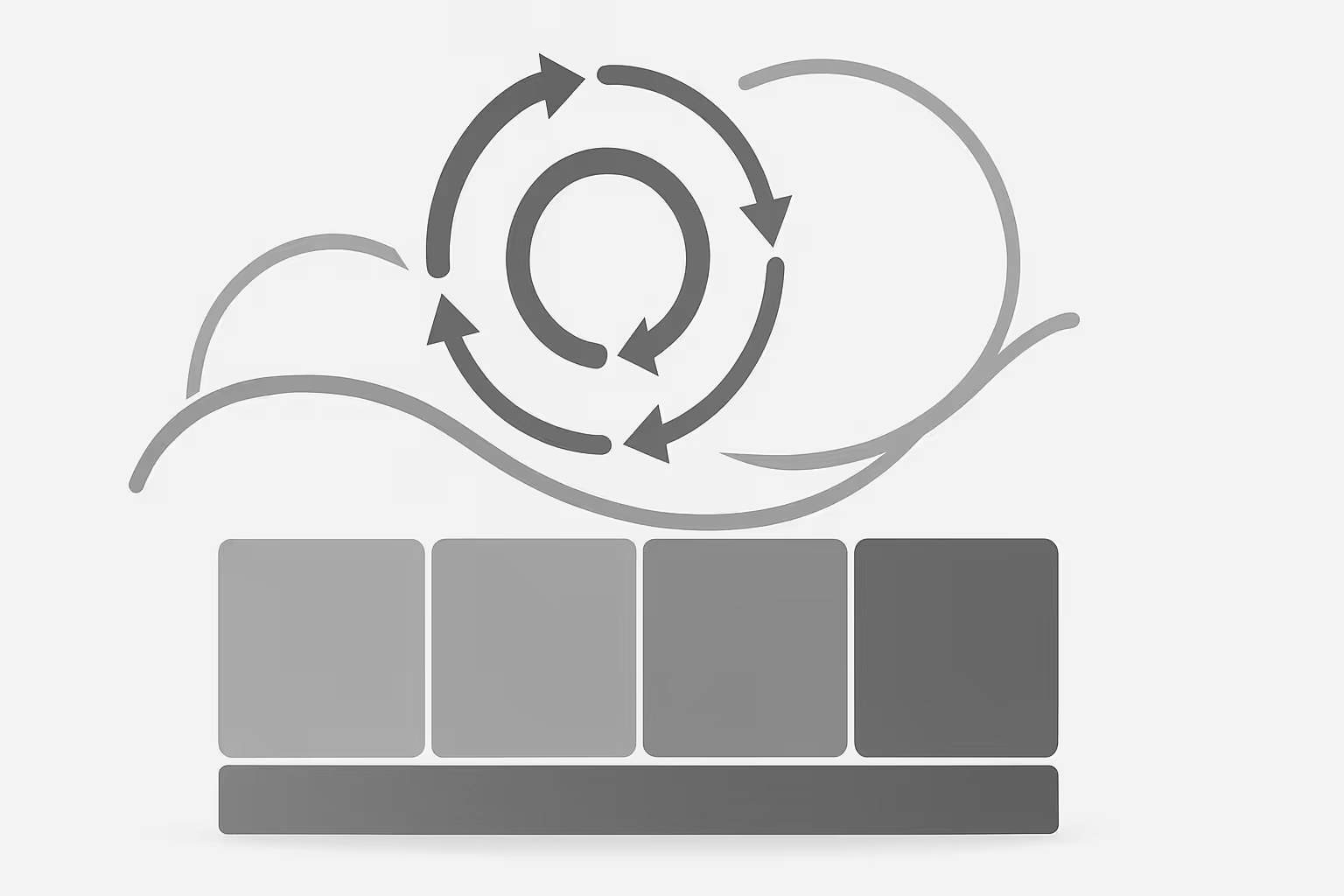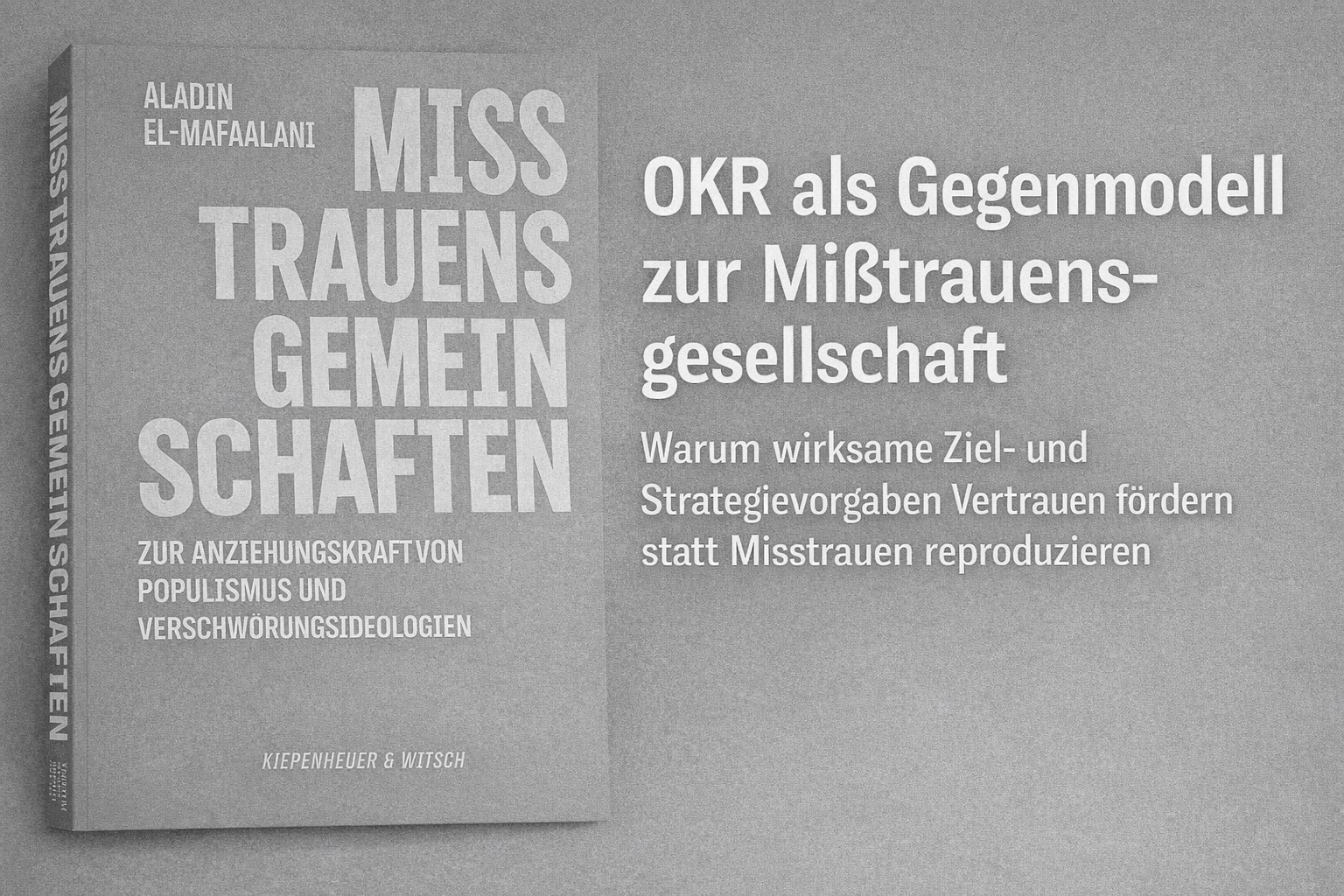Viele Unternehmen nutzen die Balanced Scorecard (BSC), um ihre Strategie messbar zu machen – und gleichzeitig Objectives & Key Results (OKR), um ihre Teams in Bewegung zu bringen.
Doch häufig bleibt unklar, wie beide Systeme zusammenspielen können.
Dabei gilt:
Die BSC zeigt die Landkarte – OKR bringt die Organisation in Bewegung.
1. Die Balanced Scorecard – Struktur für Strategieumsetzung
Die BSC wurde in den 1990ern von Kaplan & Norton entwickelt, um strategische Ziele in vier Perspektiven zu übersetzen:
- Finanzperspektive – Wie erfolgreich sind wir wirtschaftlich?
- Kundenperspektive – Wie erleben uns unsere Kund:innen?
- Prozessperspektive – Wie effizient und wirksam sind unsere Abläufe?
- Lern- & Entwicklungsperspektive – Wie zukunftsfähig sind unsere Menschen und Strukturen?
Damit liefert die BSC ein stabiles, holistisches Gerüst für Strategieumsetzung.
Doch genau hier liegt auch ihre Grenze:
Sie ist strukturiert, aber wenig adaptiv.
Strategien werden selten überprüft, Lernprozesse kaum integriert, und Veränderungen in der Umwelt fließen nur verzögert ein.
OKR füllt genau diese Lücke.
2. OKR – Bewegung, Fokus und Lernen
OKR ist kein Ersatz für die BSC, sondern deren dynamische Erweiterung.
Wo die BSC Ziele definiert, erzeugt OKR Fokus, Lernzyklen und Ownership.
Im die.agilen-Verständnis entfaltet sich OKR immer im Kontext der gesamten Architektur – also mit:
- Vision & Purpose → Warum existieren wir?
- HED (High-Level Economic Direction) → Worin liegt unser langfristiger wirtschaftlicher Erfolg?
- MED (MidTerm Economic Direction) → Welche mittelfristigen Entwicklungsfelder zahlen darauf ein?
- Moal (MidTerm Goal Picture) → Was ist das Zielbild in einem Jahr, wenn wir erfolgreich sind?
Diese Elemente bilden den strategischen Rahmen, in dem OKRs entstehen – und machen sie anschlussfähig an die BSC.
3. Wie sich BSC und OKR logisch verbinden
Statt zwei getrennte Systeme zu betreiben, lassen sich beide entlang einer klaren Steuerungskaskade integrieren:
So wird die BSC zum stabilen Fundament – und OKR zum lebendigen Umsetzungszyklus.
Die Brücke entsteht über die Outcome-Orientierung.
4. Outcome statt Output – die entscheidende Verbindung
Die klassische BSC arbeitet oft mit Kennzahlen (KPIs), die Ergebnis oder Aktivität messen.
OKR hingegen fragt:
„Welche Veränderung in der Umwelt wollen wir sehen, wenn wir erfolgreich sind?“
Beispiel:
BSC-Ziel (Kundenperspektive):
„Kundenzufriedenheit steigern.“
→ Strategische Leitidee, gemessen über KPIs wie NPS, Wiederkaufsrate, Beschwerdequote.“
OKR-Zyklus:
- Objective: „Unsere Kund:innen erleben uns als verlässlichen, lösungsorientierten Partner.“
- Key Results (Outcome-orientiert):
- 80 % der Kund:innen bestätigen, dass ihre Anliegen bereits im Erstkontakt vollständig gelöst werden.
- 70 % der Kund:innen geben an, dass sie sich aktiv unterstützt und verstanden fühlen.
- 70 % unserer Teams integrieren Kund:innen systematisch in die Lösungsentwicklung und Feedbackprozesse.
Damit wird aus einem statischen KPI („+15 Punkte NPS“) eine aktive Lernerfahrung:
Teams entdecken, was Kundenzufriedenheit wirklich beeinflusst.
5. Beispiel für integrierte Steuerung – von BSC zu OKR
Vision & Purpose:
„Wir treten für eine Wirtschaft ein, in der Menschen auf Augenhöhe, mit Wirksamkeit und Sinn zusammenarbeiten – weil echte Zusammenarbeit die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und menschliche Entfaltung ist.“
High-Level Economic Direction (HED):
„Wirtschaftlich erfolgreich durch hohe Kundenbindung und nachhaltige Wirkung.
Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf langfristiger Kund:innenbindung und einer spürbaren, positiven Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt. Dabei messen wir unseren Fortschritt an unserer North Star Metric, dem Customer Lifetime Impact Score (CLIS) – einer Kennzahl, die Kundenloyalität und nachhaltige Wirkung miteinander verbindet. Sie ergibt sich aus der durchschnittlichen Kundenbindungsdauer, der Wiederkaufquote und einem Impact-Index, der die ökologischen und sozialen Effekte unserer Leistungen abbildet.
Unsere grundlegenden Trade-off-Entscheidungen machen deutlich, wofür wir stehen: Wir setzen langfristige Beziehungen über kurzfristige Umsatzmaximierung, nachhaltige Wirkung über reine Effizienzsteigerung und gezielte Partnerschaften über Massenansprache. So bleiben wir fokussiert auf Qualität, Wirksamkeit und Sinn.
Zur Überprüfung unserer wirtschaftlichen Gesundheit dient die Health Metric Net Positive Impact Ratio (NPIR), die den Anteil unserer Aktivitäten misst, die einen nachweislich positiven Beitrag leisten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unser Wachstum ökonomisch tragfähig bleibt, ohne unsere Werte oder unsere gerechte Sache zu kompromittieren.“
MidTerm Economic Direction (MED):
„Servicequalität und Kundenerlebnis ausbauen, um Differenzierung im Markt zu stärken.
Im kommenden Jahr fokussieren wir uns darauf, unser Serviceerlebnis und die wahrgenommene Qualität unserer Leistungen kontinuierlich zu verbessern, um uns klar vom Wettbewerb zu differenzieren und Kund:innen emotional wie funktional zu binden. Unser Handeln orientiert sich dabei an den Prinzipien unserer Worthy Rivals – also jenen Marktteilnehmern, die uns herausfordern, besser zu werden, ohne dass wir sie besiegen müssen. Von ihnen lernen wir, was exzellente Serviceerlebnisse wirklich ausmacht: radikale Kundenzentrierung, konsistente Markenintegrität, mutige Innovationskultur und tiefes Verständnis für Bedürfnisse und Emotionen der Nutzer:innen.
Unsere Trade-off-Entscheidungen sind klar: Wir investieren in Qualität statt in kurzfristige Kostenvorteile, in kontinuierliche Verbesserung statt in einmalige Aktionen und in echte Kundenerlebnisse statt in oberflächliche Marketingversprechen. Damit sichern wir eine klare und glaubwürdige Differenzierung im Markt.
Die Health Metric für diese wirtschaftliche Richtung ist der Service Excellence Index (SEI), der regelmäßig misst, wie stark unsere Kund:innen die Servicequalität, Verlässlichkeit und emotionale Bindung zu unserer Marke wahrnehmen. So stellen wir sicher, dass unsere Differenzierung nicht nur behauptet, sondern tatsächlich erlebt wird – Tag für Tag, an jedem Kontaktpunkt.
MidTerm Goal Picture (Moal):
„Unsere Kund:innen arbeiten gerne mit uns zusammen, weil sie spüren, dass Zusammenarbeit mit uns einfach, menschlich und lösungsorientiert ist – und uns deshalb als ihren bevorzugten Partner wählen.““
Balanced Scorecard-Ziele:
- Kundenperspektive: Kundenvertrauen stärken
- Prozessperspektive: Fehlerfreiheit und Transparenz erhöhen
- Lernperspektive: Feedbackkultur verankern
OKR-Zyklus (Q1):
- Objective: „Unsere Kund:innen spüren, dass sie sich auf uns verlassen können.“
- Key Results:
- 90 % der Kundenanfragen werden innerhalb von 24 h zufriedenstellend gelöst (durch Kund:innen bestätigt).
- 8 von 10 Kund:innen bewerten unsere Kommunikation als „klar & empathisch“.
- Kund:innen geben regelmäßig strukturiertes Feedback in drei neu eingeführten Feedbackschleifen.
OKR-Zyklus (Q2):
- Objective: „Wir arbeiten proaktiv statt reaktiv – und verhindern Probleme, bevor sie entstehen.“
- Key Results:
- Wiederholungsanfragen sinken im Quartal um 25 %.
- 70 % der Teams leiten aus ihren monatlichen Kunden-Debriefs konkrete Verbesserungen ab.
- In 80 % der Service-Initiativen wird Kund:innen innerhalb von 4 Wochen nach Feedback eine sichtbare Verbesserung kommuniziert.
So wird strategische Richtung (BSC) zur Bewegung (OKR).
6. BSC liefert Messgrößen – OKR liefert Hypothesen
Ein zentraler Unterschied:
Beispiel:
Die BSC misst, wie viele Neukunden gewonnen wurden.
Das OKR-Team fragt:
„Wie müssen wir unser Onboarding verändern, damit Kund:innen bleiben?“
Das ist der Unterschied zwischen Reporting und Lernen.
7. Die systemische Sicht: BSC und OKR als Beobachtungsebenen
Aus systemtheoretischer Perspektive (nach Luhmann, Groth & Richter) ist Messen immer Beobachtung.
BSC ist Beobachtung 1. Ordnung (Zahlen, Fakten, Zustände).
OKR ist Beobachtung 2. Ordnung (Wie kommen wir zu diesen Zahlen? Was verändert sich im System?).
Das bedeutet:
BSC zeigt, was passiert ist.
OKR reflektiert, warum es passiert – und wie wir daraus lernen können.
8. Kontinuierlicher PDCA-Zyklus
Die Verbindung von BSC und OKR wird besonders wirksam, wenn beide in einen PDCA-Zyklus (Plan–Do–Check–Act) eingebettet werden:
- Plan: BSC liefert strategische Stoßrichtungen und KPIs.
- Do: Teams formulieren OKRs, um diese Stoßrichtungen in Bewegung zu bringen.
- Check: Ergebnisse werden mit BSC-Kennzahlen gespiegelt.
- Act: Teams passen OKRs, Strategien oder Prozesse an – basierend auf den Learnings.
So entsteht ein lernendes Steuerungssystem.
9. Fazit: Die Verbindung schafft Balance
Die Verbindung von BSC und OKR ist keine Frage von „entweder oder“, sondern von sowohl-als-auch.
- Die BSC schafft Stabilität, Struktur und strategische Klarheit.
- OKR bringt Fokus, Energie und Bewegung.
- Zusammen schaffen sie eine Organisation, die lernt, wirkt und steuert – im Einklang mit ihrem Purpose.
BSC sagt, wohin wir wollen.
OKR zeigt, wie wir unterwegs lernen, dort wirklich anzukommen.
10. Beispielhafte Struktur (die.agilen Architektur)
Vision & Purpose
↓
High-Level Economic Direction (HED)
↓
MidTerm Economic Direction (MED)
↓
MidTerm Goal Picture (Moal)
↓
Balanced Scorecard
↓
OKR-Zyklen (3–6 Monate)
11. Gefahren und typische Fehlanwendungen
Die Verbindung von BSC und OKR kann enorme Wirkung entfalten – oder ins Gegenteil kippen, wenn sie falsch verstanden wird.
Hier sind die wichtigsten fünf Gefahren, die in der Praxis immer wieder auftreten:
BSC wird zum starrem Reporting-System – OKR verliert die Lernkomponente
Viele Organisationen übernehmen die Balanced Scorecard als Kennzahlen-Cockpit und „übersetzen“ sie 1:1 in OKRs.
Das Ergebnis:
- OKRs bestehen nur noch aus Messwerten („Erhöhe Umsatz um 10 %“, „Reduziere Kosten um 5 %“).
- Die Reflexion über Wirkung, Hypothesen und Lernen verschwindet.
Gefahr: OKR wird zur reinen Zielsteuerung – und verliert seine systemische Kraft.
OKRs sind keine Reporting-Struktur, sondern Lernzyklen über Wirkung.
Verwechslung von KPI mit Key Result
BSC arbeitet mit KPIs (Key Performance Indicators) – OKR mit KRs (Key Results).
Das klingt ähnlich, ist aber konzeptionell unterschiedlich:
Beispiel:
- KPI: Kundenzufriedenheit (NPS).
- KR: 80 % unserer Kund:innen geben an, dass wir sie proaktiv über Lösungen informieren.
Gefahr: Wenn KRs nur „Kopien von KPIs“ sind, wird das System statisch.
Lösung: KPI = Messpunkt; KR = Hypothese, wie wir diesen Wert beeinflussen.
Top-down-Durchkaskadierung erstickt Selbstorganisation
Die klassische BSC folgt einer hierarchischen Kaskade („Von der Unternehmensstrategie zu Abteilungszielen zu Teamzielen“).
Wendet man dieses Prinzip auf OKR an, entsteht eine Steuerungslogik, keine Beteiligungslogik.
Das führt dazu, dass:
- Teams keine eigenen Ziele mehr formulieren.
- OKR-Master nur noch als Übersetzer der Chefziele agieren.
- Motivation und Ownership verloren gehen.
Gefahr: OKR wird zur verlängerten Hand der Strategie – statt zur Verbindung zwischen Strategie und Lernen.
Lösung:
Top-down Orientierung ja, aber Bottom-up-Dialog als Prinzip.
Die „Kopplung“ zwischen BSC und OKR sollte lose sein – nicht hierarchisch, sondern resonant.
Zu viele Metriken – Fokusverlust und Reporting-Overload
BSC neigt dazu, viele Kennzahlen zu integrieren, um alle Perspektiven abzudecken.
Wenn diese Breite ungefiltert in OKRs überführt wird, entsteht ein „Zielsalat“.
Beispiel:
Teams haben pro Zyklus 6 Objectives mit je 5 Key Results – am Ende wird alles gemessen, aber nichts verändert.
Gefahr: Teams verlieren Fokus, Priorität und Klarheit.
Lösung:
- Pro Zyklus 1–3 Objectives, max. 4–5 Key Results.
- Nicht alles messen – nur das, was wirklich Veränderung erzeugt.
Kontrolle statt Vertrauen
Wenn die BSC als Kontrollinstrument genutzt wird, schwappt diese Kultur oft unbewusst in die OKR-Welt über.
Dann werden OKR-Ergebnisse benotet, Bewertungen erstellt oder Zielerreichung mit Boni verknüpft.
Gefahr:
Menschen beginnen, Zahlen zu optimieren statt Wirkung zu erzeugen.
Lernen wird zur Risikoaktivität.
Lösung:
- OKRs sind nicht für Performance-Bewertung gedacht, sondern für Organisationslernen.
- BSC misst was war, OKR gestaltet was wird.
„Strategy by Excel“ – fehlende Integration in Vision & Purpose
Viele Unternehmen koppeln BSC und OKR nur technisch, nicht inhaltlich.
Die Folge: Es entsteht ein Zahlensystem ohne Seele.
Doch ohne die Einbettung in Vision & Purpose, HED, MED und Moal verliert das System Sinn und Orientierung.
Gefahr: Teams wissen, was sie tun sollen, aber nicht warum.
Lösung:
Jede Metrik muss rückführbar sein auf den Purpose.
Erst dann entsteht strategische Kohärenz statt KPI-Kopplung.
Fazit (erweiterte Version)
Die Kombination von BSC und OKR funktioniert dann, wenn beide ihre ursprüngliche Logik behalten, aber sich gegenseitig ergänzen:
- Die BSC schafft Struktur, Perspektive und Stabilität.
- OKR bringt Fokus, Beteiligung und Lernbewegung.
- Vision, Purpose, HED, MED und Moal geben den Rahmen für Sinn und Richtung.
Die Gefahr liegt nicht in der Kombination –
sondern darin, wenn man versucht, aus zwei Denkweisen eine zu machen.