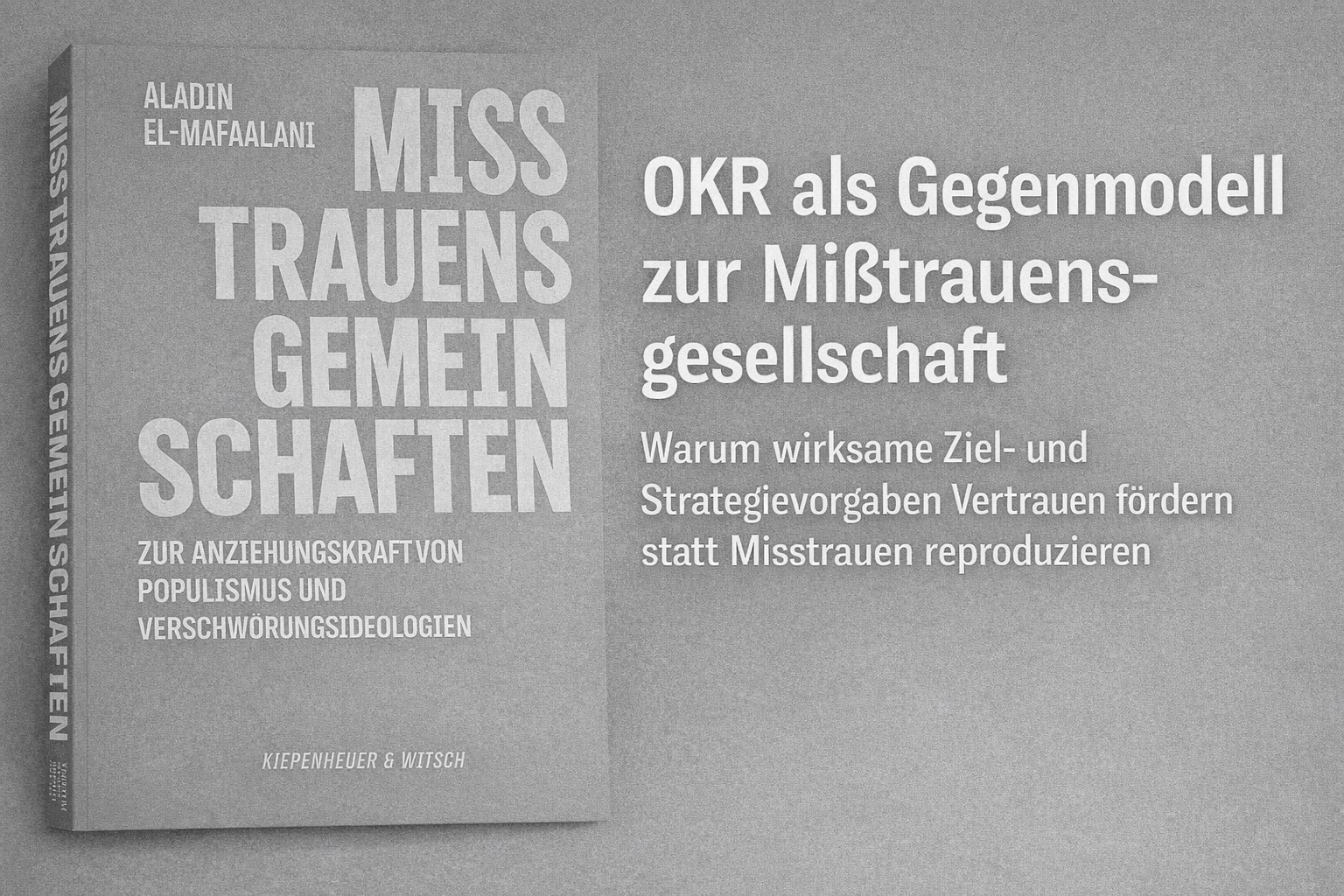Es gibt wohl kaum etwas, das uns so sehr lähmen kann wie Entscheidungen.
Egal ob im Alltag („Was essen wir heute?“, "Kaufen wir diesen neuen Fernseher?") oder im Beruf ("Senken/Erhöhen wir unsere Stundensätze?"„Wie priorisieren wir unsere Projekte?“) – manchmal drehen wir uns ewig im Kreis.
Wir wissen, dass entschieden werden muss, aber nicht wie. Und oft verstecken wir das hinter wohlklingenden Begriffen wie „Überblick gewinnen", „Konzept machen", „Strategieworkshop", „Abstimmungsprozess“, „Konsensbildung“ oder „nochmal prüfen“.
Aber warum ist das so? Warum können manche Menschen – und ganze Organisationen – keine Entscheidungen treffen?
Und warum ist genau das im OKR-Kontext so entscheidend?
Schauen wir genauer hin.
Entscheidungen in Komplexität: Entscheidbar ist nur das Unentscheidbare
In komplexen Systemen gibt es keine objektiv richtigen Entscheidungen mehr – nur noch Plausibilitäten.
Komplexität bedeutet, dass Ursache und Wirkung nicht mehr eindeutig verknüpft sind. Jede Handlung verändert das System selbst, und die Folgen sind prinzipiell unvorhersehbar.
Deshalb gilt im Sinne von Heinz von Förster:
„Entscheidbar ist nur das Unentscheidbare.“
Was paradox klingt, beschreibt eine tiefe Wahrheit: Eine Entscheidung ist erst dann eine Entscheidung, wenn sie nicht berechenbar ist.
Wäre sie durch Wissen, Erfahrung oder Logik eindeutig herleitbar, bräuchte es keine Entscheidung – sie wäre schlicht eine Ableitung.
In echter Komplexität jedoch bricht die Rationalität zusammen. Daten helfen, aber sie zeigen nur Vergangenes. Erfahrung täuscht Sicherheit vor, aber die Zukunft bleibt kontingent. Und Berechnungen erzeugen nur Scheinobjektivität.
Das bedeutet:
Entscheidungen in komplexen Umfeldern sind letztlich emotional – oder genauer gesagt: intuitiv-emotional.
Wir entscheiden aus einem Gefühl heraus, das sich aus Erfahrung, Kontextwahrnehmung und Sinnkonstruktion speist.
Emotionen sind dabei keine Störung der Rationalität, sondern deren Fortsetzung mit anderen Mitteln – sie verdichten Komplexität zu Handlung.
Das hat eine Konsequenz:
Führung in Komplexität heißt nicht, richtige Entscheidungen zu treffen, sondern Verantwortung für Ungewissheit zu übernehmen – und Räume zu schaffen, in denen Entscheidungen trotz Unsicherheit möglich sind.
Und systemisch betrachtet geht das noch tiefer:
Organisationen – also soziale Systeme – sind nicht nur um Kommunikation herum gebaut, sondern im Kern um Entscheidungskommunikation.
Ihre Existenz beruht darauf, Unentscheidbares fortlaufend zu entscheiden – und dadurch Komplexität zu reduzieren.
Jede Organisation ist somit ein permanenter Entscheidungsprozess, ein Kommunikationsstrom, der die Welt in handhabbare Alternativen übersetzt.
Sobald dieser Fluss stockt, verliert die Organisation ihre Funktion – sie hört auf, zu entscheiden, und damit auf, zu handeln.
Die psychologische Dimension: Angst, Verantwortung und das Bedürfnis nach Sicherheit
Psychologisch betrachtet ist Entscheidungsvermeidung kein Zeichen von Schwäche, sondern ein hochintelligenter Schutzmechanismus.
Unser Gehirn hasst Verlust – und jede Entscheidung bedeutet: Wir verzichten auf Alternativen.
Diese Verlustaversion (Kahneman & Tversky) ist tief in uns verankert. Wir überhöhen das, was wir verlieren könnten, und unterschätzen, was wir gewinnen könnten.
So entsteht Angst: vor Fehlern, vor Kritik, vor Reue.
Hinzu kommt: Entscheidungen sind Identitätsakte.
Wer entscheidet, übernimmt Verantwortung – und damit auch Schuld, wenn es schiefgeht.
Viele Menschen haben gelernt, dass Fehler bestraft werden. Kein Wunder also, dass sie lieber nichts entscheiden, als „falsch“ zu entscheiden.
Das führt zu klassischen psychologischen Mustern:
- Perfektionismus: „Ich will erst sicher sein, bevor ich entscheide.“
- Abhängigkeit: „Ich warte, bis mein Chef etwas sagt.“
- Harmoniebedürfnis: „Ich will niemandem wehtun, also lieber gar nichts tun.“
Kurz: Wir vermeiden Entscheidungen, um unser Selbstbild zu schützen.
Für "Entscheider" (z.B. Führungskräfte, Geschäftsführer, ...) allerdings ist die Kompetenz ("zu entscheiden") allerdings lebensnotwendig - denn es bräuchte den Entscheider nicht mehr, wenn er/sie denn nicht entscheidet (oder die Entscheidung herbeiführt).
Dabei ist es ggf. wichtig zu betonen, dass die "Nicht-Entscheidung" zwar eine Entscheidung ist, aber keine, die man trifft, sondern diese trifft einen.
Die systemische Dimension: Wenn Nicht-Entscheiden zur Strategie wird
Systemisch betrachtet geht es nicht um Individuen, sondern um Beziehungsdynamiken.
In sozialen Systemen – Teams, Organisationen, Familien – ist jede Entscheidung eine Kommunikation mit Folgen.
Sie verändert Erwartungen, Rollen und Machtverhältnisse.
Darum entwickeln Systeme häufig Strategien der Entscheidungsvermeidung, die erstaunlich stabil sein können:
- Verantwortlichkeiten werden diffus („Das Team entscheidet gemeinsam“, "Es fehlen die richtige Rolle zum Entscheiden").
- Prozesse werden endlos verlängert („Wir brauchen noch ein Alignment“, "Das ist doch schonmal ein Anfang", "Schau, wieviele Kärtchen wir schon haben").
- Entscheidungen werden formalisiert („Wir prüfen das im nächsten Lenkungskreis“, "Gut, dass wir soviel darüber geredet haben, lass uns das mal dokumentieren").
So entsteht die Illusion von Aktivität – ohne dass sich tatsächlich etwas bewegt.
Systemtheoretiker wie Niklas Luhmann beschreiben das als Paradoxie:
„Entscheidungen erzeugen Unsicherheit, weil sie Alternativen vernichten.“
Und genau diese Unsicherheit versuchen Systeme zu vermeiden – indem sie lieber gar nicht entscheiden.
Das perfide daran: Nicht-Entscheiden ist selbst eine Entscheidung.
Nur eben eine, die Energie kostet, Orientierung raubt und Handlungsfähigkeit lähmt.
Die Brücke: Warum OKR Entscheidungsfähigkeit fördert
Genau hier setzt das OKR-System an.
Es zwingt Organisationen, Entscheidungen sichtbar, rhythmisch und gemeinsam anschlussfähig zu machen.
OKR verlagert Entscheidungen bewusst auf die Team-Ebene – dahin, wo das Wissen sitzt.
Aber das funktioniert nur, wenn die psychologischen und systemischen Voraussetzungen stimmen.
Die psychologischen Voraussetzungen: Autonomy, Mastery, Purpose
OKR lebt von Selbststeuerung.
Doch Selbststeuerung funktioniert nur, wenn Menschen sich sicher, kompetent und sinnorientiert fühlen.
Daniel H. Pinks Dreiklang aus Autonomy, Mastery und Purpose beschreibt das perfekt:
Autonomy – Freiheit in Verantwortung
Teams brauchen Entscheidungsräume.
Nicht völlige Freiheit, sondern aligned autonomy:
Entscheidungen im Rahmen gemeinsamer Ziele.
Nur wer entscheiden darf, kann sich verantwortlich fühlen.
Mastery – Kompetenz erleben
Entscheidungen setzen Vertrauen in die eigene Fähigkeit voraus.
Das entsteht durch Feedback, Transparenz und Lernen – genau das, was OKR durch regelmäßige Check-ins, Reviews und Retros schafft.
Purpose – Sinn und Richtung
Ein starkes „Warum“ entlastet das „Wie“.
Wenn das Ziel klar ist, werden Entscheidungen leichter, weil sie eingebettet sind in einen Sinnzusammenhang.
Ohne Purpose wird jede Wahl beliebig – und damit bedrohlich.
Die systemischen Voraussetzungen: Rahmen, Rhythmus, Rollen
Systemisch braucht Entscheidungsfähigkeit Struktur – nicht Kontrolle.
OKR schafft sie durch:
Damit wird Entscheidungsfähigkeit institutionalisiert: Sie hängt nicht mehr von der „Stärke“ einzelner Personen ab, sondern ist im System verankert.
Psychologisch-systemisches Zusammenspiel: Die Dynamik von Sicherheit und Verantwortung
Wenn psychologische Sicherheit und systemische Klarheit zusammenkommen, entsteht Entscheidungsfähigkeit:
OKR schafft diese Integration, indem es beide Seiten bedient:
- Es fordert Entscheidungen durch Zyklen, Planningsund Reviews,
- Es ermöglicht Entscheidungen durch Sinn, Klarheit und Feedback.
Fazit: Entscheidungsfähigkeit ist kein Charakterzug – sie ist eine Kulturleistung
Menschen und Organisationen treffen keine Entscheidungen, weil sie Angst haben: vor Verlust, Konflikt oder Verantwortung.
Diese Angst ist menschlich – und systemisch oft sogar funktional.
Doch wer wirksam sein will, braucht Entscheidungsfähigkeit.
Und die entsteht dort, wo psychologische Sicherheit und systemische Klarheit zusammenwirken.
OKR ist deshalb nicht nur ein Zielsystem, sondern ein Entscheidungssystem.
Es bringt uns aus der Ohnmacht des „Man müsste mal“ in die Verantwortung des „Wir haben entschieden“.
Und genau dort beginnt Wirksamkeit.