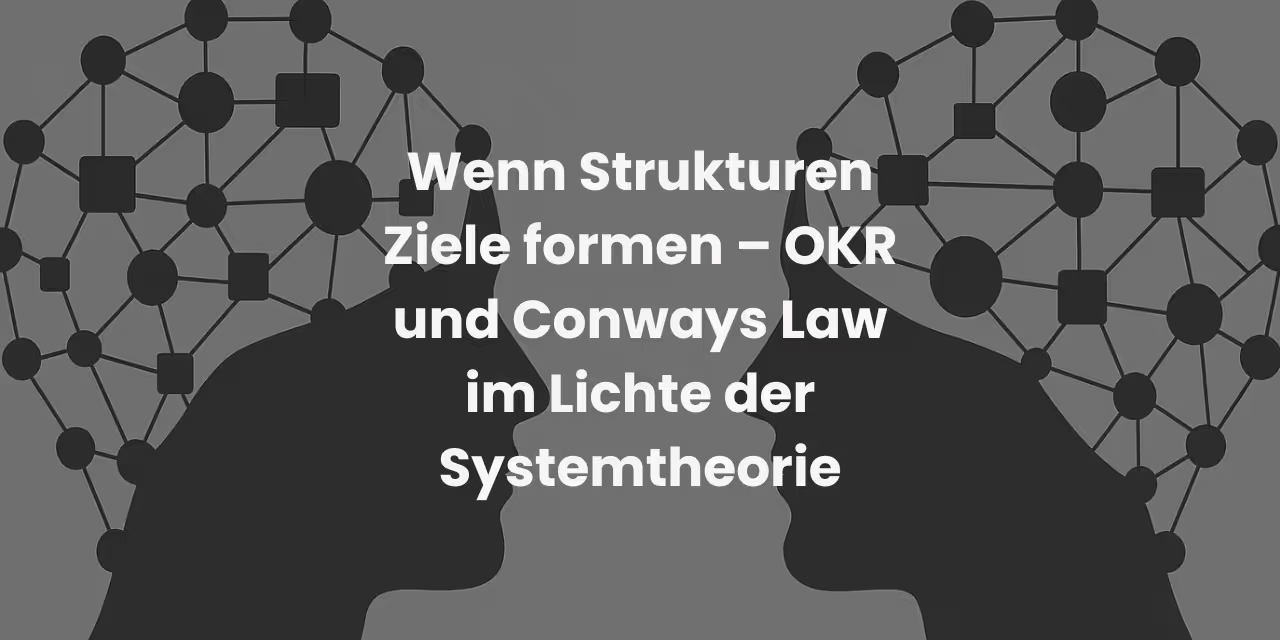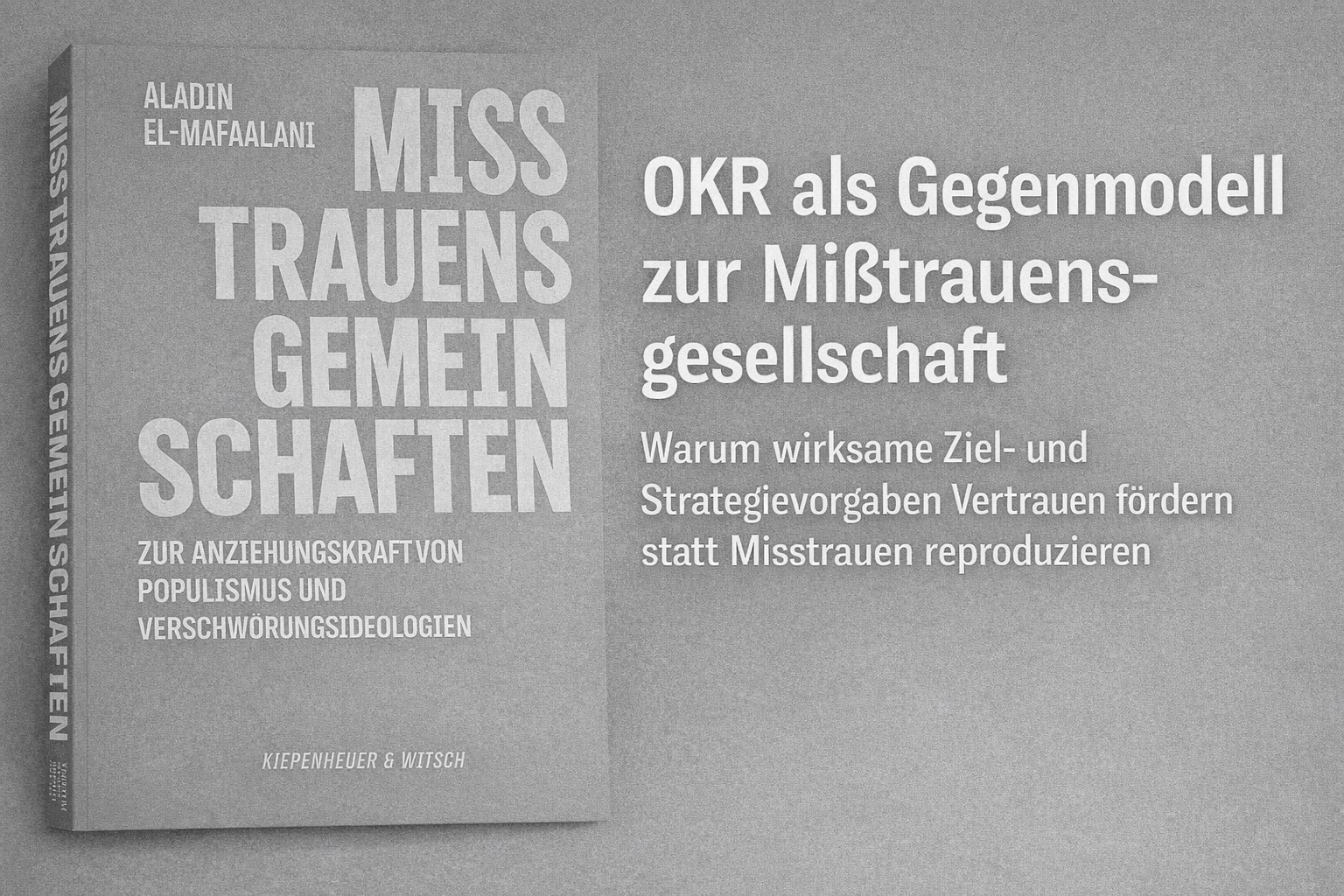Einleitung
„Any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization’s communication structure.“
— Melvin E. Conway, 1968
Conways Law beschreibt ein fundamentales Prinzip sozialer Systeme: Die Art und Weise, wie Menschen in einer Organisation miteinander kommunizieren, bestimmt, wie ihre Produkte, Prozesse und Strukturen aussehen. Dieses Gesetz wird oft in der Softwareentwicklung zitiert („vier Teams – vier Module“), greift aber viel tiefer: Es offenbart, wie Organisationen durch ihre eigenen Kommunikationsmuster geprägt werden.
Wenn wir nun OKR (Objectives and Key Results) betrachten – in der von die.agilen vertretenen Form als reflexives Führungs- und Lernsystem – wird schnell klar, dass beide Konzepte sich gegenseitig beeinflussen:
OKR will den Fokus, die Ausrichtung und die Lernfähigkeit einer Organisation erhöhen. Doch Conways Law mahnt: Diese Ziele sind nur so gut erreichbar, wie es die Kommunikationsstrukturen zulassen.
Um zu verstehen, wie Organisationen hier wirklich „wirksam“ werden, lohnt sich ein Blick durch die Brille der Systemtheorie nach Niklas Luhmann.
1. Conways Law als Spiegel organisationaler Kommunikation
Conways Law besagt im Kern, dass Organisationen die Grenzen ihrer eigenen Kommunikation nicht überschreiten können.
Wenn ein Unternehmen in Silos denkt, werden auch seine Produkte „siloförmig“.
Wenn Teams hierarchisch kommunizieren, wird auch ihr Produktarchitektur starr und bürokratisch.
Beispiel:
Ein klassisches Beispiel aus der IT-Welt: Ein Unternehmen hat getrennte Teams für Frontend, Backend und Datenbank. Das Ergebnis ist oft eine Architektur mit exakt diesen Grenzen – unabhängig davon, ob das für den Nutzer sinnvoll ist.
Umgekehrt: Ein cross-funktionales Produktteam, das gemeinsam an einem Ziel arbeitet, wird meist eine integriertere, nutzerzentrierte Lösung hervorbringen.
Im systemtheoretischen Sinn ist das kein Zufall, sondern Ausdruck der Selbstreferenzialität sozialer Systeme:
Kommunikation reproduziert Kommunikation.
Was und wie kommuniziert wird, definiert, was das System wahrnimmt und wie es sich selbst weiterentwickelt.
2. OKR als reflexives Kommunikationssystem
Das von die.agilen propagierte Verständnis von OKR geht weit über das „Management-by-Objectives“ hinaus. Es versteht OKR als soziales Lernsystem, das Kommunikation sichtbar, strukturiert und iterativ gestaltet.
Jeder OKR-Zyklus zwingt die Organisation dazu, über ihre Ziele, Prioritäten und Wirkzusammenhänge zu sprechen – und zwar regelmäßig und systematisch.
OKR macht also die internen Kommunikationsmuster explizit und überprüfbar.
In Luhmanns Sprache: OKR ist eine Kommunikation über Kommunikation – eine Form der Reflexion, die neue Möglichkeiten der Selbstbeobachtung schafft.
Beispiel:
Ein Unternehmen stellt fest, dass Teams zwar ambitionierte Objectives formulieren, die Key Results aber ausschließlich Output-Metriken beschreiben („Anzahl neuer Features“ statt „Nutzerzufriedenheit“).
Im OKR-Review wird deutlich: Das System kommuniziert lieber über Tätigkeiten als über Wirkungen.
Durch diese Reflexion kann das Unternehmen seine Kommunikationslogik verändern – von „Was tun wir?“ hin zu „Was bewirken wir?“.
So wird OKR zum Instrument, das Conways Law bewusst macht – und Organisationen hilft, ihre Kommunikationsmuster gezielt zu verändern.
3. Systemtheoretische Perspektive: Organisationen als autopoietische Systeme
Nach Luhmann sind Organisationen keine Maschinen, sondern autopoietische Systeme, die sich selbst durch Kommunikation erzeugen und erhalten.
Ziele, Strategien oder Strukturen existieren nicht unabhängig von dieser Kommunikation – sie sind Kommunikation.
Das hat zwei zentrale Konsequenzen:
- Veränderung durch Einführung von OKR ist nicht trivial.
- Man kann nicht einfach „OKR einführen“ – man verändert Kommunikationsroutinen, Entscheidungslogiken und Beobachtungsweisen.
- Wer OKR implementiert, greift also in die operative Autopoiesis des Systems ein.
- Conways Law wird zum Beobachtungsinstrument.
- OKR macht sichtbar, welche Kommunikationsstrukturen wirksam sind – und wo sie das Lernen behindern.
- So lässt sich erkennen, warum bestimmte OKRs nie erreicht werden: nicht, weil Menschen unmotiviert sind, sondern weil das System ihre Kommunikation strukturell einschränkt.
Beispiel:
Ein Unternehmen formuliert als Objective:
„Wir steigern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um Kundenerlebnisse zu verbessern.“
Doch in der Praxis hat jedes Team eigene OKRs, getrennte Meetings, unterschiedliche Tools.
Die Struktur erzwingt Trennung – Conways Law greift.
Das Ergebnis: keine echten Fortschritte, sondern parallele Aktivitäten.
Erst wenn die Organisation beginnt, OKRs über Teamgrenzen hinweg zu denken (z. B. gemeinsame Outcome-Objectives für ganze Wertströme), kann sich die Kommunikation verändern – und damit auch das Ergebnis.
4. OKR als Gegenkraft zu Conways Law
Man könnte sagen:
Conways Law beschreibt die Begrenzung von Organisationen – OKR beschreibt den Weg, diese Begrenzung zu reflektieren.
OKR kann Conways Law nicht „aufheben“, aber bewusst machen und dadurch handhabbar machen.
Es schafft eine wiederkehrende Gelegenheit, über folgende Fragen zu sprechen:
- Passen unsere Kommunikationsstrukturen zu unseren Zielen?
- Wer redet mit wem – und wer sollte miteinander reden?
- Welche Schnittstellen sind hinderlich für Wirkung?
Indem OKR Kommunikation systematisiert, ermöglicht es, die Organisation an ihren eigenen Grenzen zu beobachten – ein zentrales Prinzip systemischer Führung.
5. Praxisbeispiel: Von Silos zu Wertströmen
Ein mittelständisches Technologieunternehmen führt OKR ein.
Zunächst setzen alle Abteilungen ihre eigenen Ziele:
- Vertrieb: „10 % Umsatzsteigerung“
- Marketing: „Mehr Leads“
- Produkt: „Neue Features launchen“
Das Ergebnis: keine Abstimmung, viele Missverständnisse, kaum Wirkung.
Die OKR-Reviews zeigen: Die Kommunikation findet nur innerhalb der Abteilungen statt – ein klassischer Fall von Conways Law.
In der zweiten Iteration werden gemeinsame Objectives entlang der Wertschöpfungskette formuliert:
„Kundenzufriedenheit im Onboarding-Prozess um 15 % steigern.“
Plötzlich entstehen cross-funktionale Austauschformate: Vertrieb, Produkt und Support sprechen regelmäßig miteinander, teilen Daten, verstehen Abhängigkeiten.
Das Produkt verändert sich – weil sich die Kommunikation verändert hat.
6. Fazit: Kommunikation bestimmt Struktur – und Struktur bestimmt Erfolg
Conways Law erinnert uns daran, dass jede Organisationsstruktur ein Spiegel ihrer Kommunikation ist.
OKR – verstanden als reflexives, lernendes System – ist ein Werkzeug, um diese Strukturen bewusst zu beobachten und gezielt zu verändern.
Im Luhmannschen Sinne führt OKR zu einer höheren Selbstbeobachtungsfähigkeit des Systems:
Organisationen lernen, sich selbst zu verstehen, zu irritieren und weiterzuentwickeln – nicht trotz, sondern durch ihre eigene Kommunikation.
So wird OKR zu mehr als einem Management-Tool:
Es wird zu einem sozialen Resonanzraum, in dem Conways Law nicht länger unbewusst wirkt, sondern zum Ausgangspunkt organisationaler Entwicklung wird.
Kurz gesagt:
- Conways Law erklärt, warum Organisationen so handeln, wie sie handeln.
- Luhmanns Systemtheorie erklärt, wie sie sich selbst erhalten.
- OKR bietet den Rahmen, um beides zu reflektieren und gezielt zu verändern.
Oder einfacher:
Wer anders wirken will, muss anders kommunizieren.
Und wer anders kommunizieren will, braucht Strukturen, die das zulassen – oder OKR.